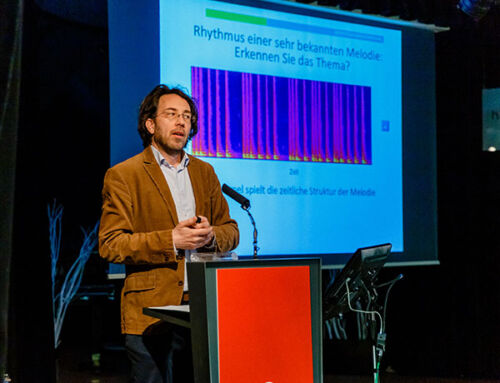Musik kommuniziert Emotionen
Ein Gespräch über praktische und wissenschaftliche Aspekte des Musikhörens mit Univ. Prof. DDr. Andrej Kral, der im Bereich der experimentellen Otologie an der Medizinischen Hochschule Hannover forscht.
Eva Kohl
„Im optimalen Fall führt unsere Forschung zu einer Verbesserung der klinischen Behandlung von Patienten“, erklärt Univ. Prof. DDr. med. Andrej Kral. Der Mediziner hat einen Lehrstuhl für audiologische Neurowissenschaften inne und leitet die Abteilung für experimentelle Otologie an der Hochschule Hannover in Deutschland.
Otologie bedeutet Ohrenheilkunde, oder eigentlich Ohrenkunde. „Wir verstehen das breiter. Zum Hören gehört ja nicht nur das Ohr, sondern auch das Gehirn.“ Kral untersucht mit seinem Team jene medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen, welche die Praktiker der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde nutzten, um Patienten mit Hörproblemen zu helfen. Musik – als spezielle Form dessen was wir hören – ist ein Teil davon.
„Musik ist ein menschliches Phänomen!“
Psychologen der Universität im britischen Leicester belegten in einer Studie an über 1000 Kühen, dass diese mehr Milch geben, wenn sie beruhigende Musik hören. Die Forscher wollen sogar festgestellt haben, dass einzelne Kühe Lieblingsstücke hätten: häufig Beethovens 6. Symphonie oder Bridge Over Troubled Water von Simon und Garfunkel.
„Kühe sind an Schallereignissen sehr interessiert.“ Kral bleibt bezüglich Musikalität von Tieren aber skeptisch. „Ich würde das nicht als Musikwahrnehmung beschreiben, sondern eher als Interesse und als positives Empfinden eines Wohlklangs.“ Er spricht Videos an, in denen Katzen mit offenbarem Vergnügen die Tasten eines Klaviers betätigen, Hunde bei Musikstücken mitheulen oder ein Kakadu zur Musik wippt. „Diese Reaktion ist ein biologisches Verhalten“, widerspricht der Wissenschaftler einer Vermenschlichung vierbeiniger oder geflügelter Hausgenossen. „Ob Tiere Musik genießen, ist letztlich nicht geklärt. Doch Musik ist für mich ein menschliches Phänomen, denn nur Menschen komponieren Musik.“
„Bei den meisten Vogelarten singen nur die Männchen“, erklärt Kral. „Deren Gesang hat keine rein ästhetische Funktion.“ Der Gesang soll das Revier abstecken und potentielle Partner anlocken. Als Sprache kann diese Form der Lautäußerung nicht bezeichnet werden: „Es entsteht ja in der Regel kein Dialog.“ Weder Musik, noch Sprache – handelt es sich trotzdem um Kommunikation mittels Schall. „Natürlich hat das akustisch Ähnlichkeiten mit unserem Gesang. Der Gesang von Tieren ist vielleicht ein phylogenetischer Vorläufer unserer Kommunikation, letztlich aber ist es doch ein anderes Phänomen.“
Musik unterscheidet sich qualitativ von Sprache
Musik soll Emotion ausdrücken und transportieren. Somit ist sie ein Kommunikationsmittel. Sprache geht aber viel weiter. Sie benutzt Symbole, um komplexe Informationen über die reine Emotion hinaus zu vermitteln und kann beliebige Inhalte transportieren. Das kann Musik nicht. Zudem hat Sprache eine hierarchische Struktur: Buchstaben, beziehungsweise Laute oder Phoneme, Wörter oder Morpheme, sowie Sätze. „Jedes Phonem ist ein potentiell sinntragendes Element.” Man kann zwei Wörter finden, sogenannte Minimalpaare, die sich durch nur ein Phonem unterscheiden: beispielsweise Durst und Wurst. „Der Sinn des Wortes ergibt sich aus der Kombination mehrerer Phoneme. Sinnvoll zusammengesetzte Wörter ergeben dann sinnvolle Sätze oder Aussagen, die zu einer Geschichte mit beliebigem Inhalt werden können. Auch wenn Musik Motive und Phrasen kennt, ist die Diskretisierung der Bedeutung in genau definierte, hierarchische Struktur der Musik fremd“, erläutert Kral.
Beim Hören gibt es zwar einen gemeinsamen Anteil in der Verarbeitung von Sprache und Musik, sie werden aber ganz unterschiedlich verarbeitet. „Bei der Musik sind das mesolimbische System, das für die Emotionen zuständig ist, und die rechte Hirnrinde involviert. Die Sprachareale hingegen – das
Wernicke-Areal und Broca-Areal – liegen normalerweise links und sind bei der Musik nicht aktiv. Gesang kann beides kombinieren, da vermischt sich Sprache mit Musik.“
Die Sinne können einander nicht kompensieren
Jedem Sinn sind gewisse Regionen in der Hirnrinde zugeordnet. Die neuronalen Strukturen der Hirnrinde sind plastisch, sodass sie bei fehlender Aktivierung teilweise neue Aufgaben übernehmen können. „Ein blinder Musiker kann mitunter Facetten des Schalls wahrnehmen, die ein sehender Musiker nicht heraushört. In ähnlicher Weise verbessert sich bei gehörlosen Menschen durch die Plastizität des Gehirns die visuelle Lokalisation in der Peripherie des Gesichtsfeldes sowie die visuelle Bewegungsdetektion.“ Lange dachte man, ein ausgefallener Sinn werde auf diese Weise durch die anderen Sinne kompensiert. Der Neurowissenschaftler ist überzeugt: „Das geht leider nicht. Das Auge ist ja zum Beispiel viel langsamer als das Ohr.“
Der Hochschulprofessor verwendet ein Beispiel: Filme bestehen aus der raschen Abfolge von Einzelbildern. Beim Stummfilm verwendete man 16 Hertz als Bildwechselfrequenz, später 24 Hertz – alte Fernseher oder Monitore flackerten oft. Seit die Bildwechselfrequenz teilweise schneller als 60 Hertz ist, können wir den Wechsel des Bildes nicht mehr wahrnehmen, es verschmilzt in den Eindruck einer Bewegung. Das Gehör lässt sich in der zeitlichen Abfolge nicht so leicht täuschen, es arbeitet fast hundert Mal schneller als das Auge. „Dafür ist das Auge exzellent in räumlicher Lokalisation“, erklärt Kral. „Das Ohr gibt dem Gehirn die Zeitachse, das Sehen gibt ihm den Raum. Das Ohr kennt Mozart, das Auge van Gogh.“
„Wir sollten nicht vergessen, dass die meisten natürlichen Reize mehrere Sinnessysteme ansprechen, und diese dann in assoziativen Arealen zusammen verarbeitet werden. Ein fahrender Zug erzeugt beides – akustische und visuelle Reize, und sie beide zusammen machen den fahrenden Zug aus. Die Welt ist multimodal, aber jedes Sinnessystem hat seinen spezifischen Beitrag dazu.“
Leuchtende Emotionen
Beim Hören gelangt der Schall über das Außen- und Mittelohr in das Innenohr. Dort sitzt das Cortische Organ mit Haarzellen, welche Schall in Nervensignale umwandeln. Schon in den zirka zehn Millisekunden, bis die Signale zum auditorischen Kortex gelangen, werden viele seiner Eigenschaften schon teilweise ausgewertet. Die primären Areale der auditorischen Hirnrinde erkennen die Tonhöhe, Lautstärke und Position im Raum. Aus diesen Eigenschaften entstehen in höheren, sekundären Arealen dann Objekte: das Miauen einer Katze, das Bellen eines Hundes, die Hupe eines Autos.
Die auditorischen Areale arbeiten als Einheit. Welche Emotionen das Gehörte hervorruft, wird mitbestimmt von der geplanten Handlung, unseren früheren Erfahrungen und welche Assoziation wir mit bestimmten Höreindrücken verbinden. „Dies gilt für alle Sinneseindrücke, insbesondere auch für Musik.“
„Es ist generell schwer zu definieren, was man fühlt“, erklärt der Neurowissenschaftler. „Dieses Problem haben wir bei vielen Phänomenen. Ich bitte manchmal Studenten zu beschreiben, wie sie die Farbe Rot empfinden; was sie fühlen, wenn sie diese Farbe sehen. Dann merkt man, dass man das nicht einfach definieren kann.“ Ebenso schwierig ist es zu beschreiben, was wir beim Musikhören empfinden.
In der Philosophie gibt es dafür den Begriff Qualia: Wie fühlt sich etwas an, welche Qualität hat es. Naturwissenschaftler verwenden bildgebende Verfahren oder elektrophysiologische Ableitungen, um die neuronale Reaktion zu beobachten: Aktive Regionen im Gehirn leuchten auf diesen Aufnahmen auf. „Wenn Menschen Musik hören, sieht man Bereiche des neuronalen Netzwerks aufleuchten, die normalerweise mit der Verarbeitung von Emotionen in Zusammenhang gebracht werden.“ Wie sich das anfühlt, bleibt dabei aber offen.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten
Warum sich Musikgeschmack unterschiedlich ausbildet, ist aus neurowissenschaftlicher Sicht noch nicht erklärbar. Quantitativ erfassbar ist das Konzept der Konsonanz und Dissonanz: Manche
Verhältnisse zwischen zwei Tönen – oder zwischen den spektralen Maxima zweier Klänge – empfinden wir als angenehm und harmonisch: Sie sind konsonant oder wohlklingend. Liegen die spektralen Maxima nahe beisammen, innerhalb eines sogenannten kritischen Bandes, empfinden wir das als „eine Art Flattern oder Knattern“, wie Kral es beschreibt. „Eine Rauheit“, die meist als unharmonische Dissonanz empfunden wird. „Möglicherweise gibt es in der Natur mehr harmonische als unharmonische Schallereignisse, und deswegen präferieren wir diese.“
Wesentlichen Einfluss auf unsere musikalischen Vorlieben habe es, welche persönlichen Erfahrungen wir mit einer Musikrichtung oder einem Musikstück verbinden. „Musik kann uns zurückbringen in ein gewisses Gefühl oder einen gewissen Moment“, den ersten Kuss etwa oder die Weihnachtszeit der Kindheit.
„Die Klinke an der Tür“ zum Lernen
Mit Musik verbundene Erinnerungen können für Menschen mit Demenzerkrankungen ein Schlüssel nicht nur zu Erinnerungen sein. Kral nennt als Beispiel einen ehemaligen Musiker, der demenzbedingt nicht mehr auf seine Umgebung reagiert. „Wenn er Musik hört, öffnet er sich und man kann einige Minuten gezielt mit ihm reden.“ Der direkte Zugang der Musik zu den neuronalen Schaltkreisen der Emotion könne Menschen für einen sensorischen Eingang empfänglich machen und damit den Zugang und das Abspeichern ermöglichen. „Wie eine Klinke an der Tür, die man aufmachen möchte.“
Eine US-amerikanische Forschungsgruppe zeigt, dass Musiker Sprache im Störgeräusch auch auditiv besser verarbeiten. „Ob dieser Effekt spezifisch ist, ist jedoch noch nicht 100 Prozent geklärt“, ist Kral vorsichtig. „Die Hypothese, ob man mit Musik auch das Sprachverständnis verbessern kann, ist umstritten. Aber es gibt einen Bereich in Gehirn, den beide Phänomene benutzen. Für Musikwahrnehmung benutzt man auch das Gehör, es kann also sein, dass aktives Zuhören sozusagen als Lateraleffekt das Sprachverständnis verbessert.“
Cochlea-Implantation soll sprachliche Kommunikation ermöglichen. „Man muss schauen, wo und wie man dazu Musiktherapie gezielt einsetzen kann.“ Für die klinische Praxis sei auch die gesicherte Effizienz im Vergleich mit der Effizienz anderer Therapiekonzepte wichtig. „Wenn ein CI-Patient sich durch die Musik vermehrt mit dem Hören beschäftigt, ist das aber auf jeden Fall positiv.“